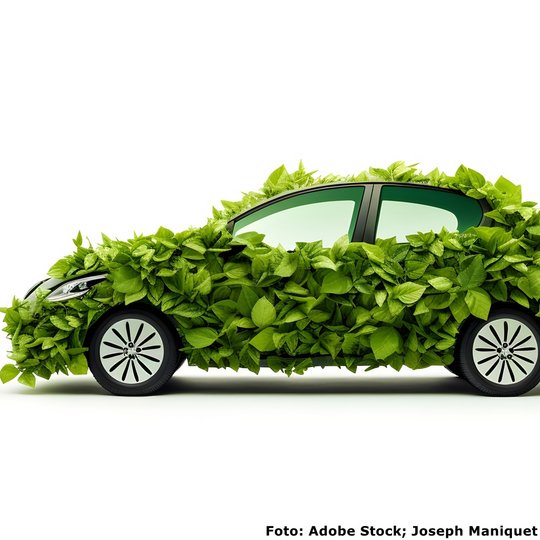Wirtschaftliches Denken und Handeln: Anwendung und Förderung im Lernfeld Kfz-Gewerbe
Wenn es darum geht, wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich und praxisnah zu vermitteln, gelingt dies am besten durch anschauliche und lebensnahe Beispiele. Das Kfz-Gewerbe prägt die Mobilität im Alltag der Schülerinnen und Schüler – was diesen Bereich zu einem interessanten Lehrbeispiel macht. Dieser Fachartikel zeigt, welche Anknüpfungspunkte zwischen lehrplanrelevanten Themen aus Politik und Wirtschaft der Sekundarstufe I und II und dem Kfz-Gewerbe bestehen.
- Wirtschaft / Politik / WiSo / SoWi
- Sekundarstufe II, Sekundarstufe I

Wirtschaftliche Herausforderungen: Gewinne, Kosten, Leistung
Die Automobilbranche ist vielleicht in der schwersten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Diese Herausforderung legt schonungslos offen, dass auch das
Kfz-Gewerbe marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dem Gesetz von Angebot und Nachfrage unterliegt.
Jedes Unternehmen, so auch handwerkliche Betriebe, muss Gewinne erzielen, um bestehen zu können. Gewinne wiederum sind abhängig von den Einnahmen des Unternehmens einerseits, den Kosten andererseits. Betriebe müssen zudem fähig sein, ihre Leistungen überhaupt zu erbringen, was wiederum von Personal, Arbeitsmitteln, Rohstoffen und vielen anderen Faktoren wie beispielsweise gesetzlichen Auflagen abhängig ist. Kfz-Betriebe können daher auf Dauer nur bestehen, wenn ihre Einnahmen größer als die Ausgaben für Arbeitskräfte, Fahrzeuge, Werkstattausrüstung, Werkzeuge, Materialverbrauch, Werbung, Lizenzen und Kredite sind und noch ein finanzieller Spielraum für neue Investitionen, Rücklagen für Krisenzeiten und den Gewinn dem Unternehmen verbleibt.
Wertschöpfung und Produktion im Kfz-Gewerbe

Das Kfz-Gewerbe ist aber auch in hohem Maße von der technischen Entwicklung abhängig. Gerade die Entwicklung hin zu Elektrofahrzeugen, weiteren alternativen Antrieben, autonomem Fahren, vernetzten Fahrzeugen und damit Digitalisierung wird auch in der Fahrzeugwartung, -reparatur und -dienstleistung einen fundamentalen Wandel der Arbeitswelt und der Wertschöpfung (sprich: Gewinnerzielung) mit sich bringen. Dies eröffnet zwar neue Ertragsfelder, andererseits ist dieser Wandel mit hohen Investitionen verbunden.
Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass die Kfz-Branche in eine umfassende, komplexe und weltweite Wertschöpfungskette eingebunden ist, die von der Eisen- und Lithium-Gewinnung und der Stahl- und Kunststofferzeugung im Rohstoffbereich über die Herstellung der Automobile, Motorräder und Zugmaschinen mit ihren zahlreichen Zulieferbetrieben, den Verkauf und die Auslieferung bis hin zu Wartung, Reparatur, Service, dem Zweithandel mit Kfz, der Vermietung von Kfz und schließlich Recycling und Entsorgung reicht. Dazu kommen noch die Vorgaben der Politik für die Herstellung und Wartung der Fahrzeuge und die Einkommenssituation und Kaufbereitschaft der Kunden als weitere Handlungsrestriktionen der Betriebe.
Digitalisierung und Vernetzung
Internet und Künstliche Intelligenz werden die Kfz-Branche in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. Bedeutet doch Digitalisierung nicht nur den Webauftritt von Unternehmen, eine veränderte Kunden- und Mitarbeiterkommunikation und digitale Assistenzsysteme für Fahrerinnen und Fahrer und Beifahrerinnen und Beifahrer, sondern eine komplexe Umstellung von Produktion, Vertrieb und Wartung. Automatisierte Produktionsstraßen mit Robotern, Kfz-Überwachung und -Lenkung per GPS sowie autonome oder zumindest teilautonome Fahrzeuge sind nur ein paar Stichpunkte hierfür, mit den entsprechenden rechtlichen Konsequenzen für Haftung und Gewährleistung. IT und KI sorgen für neue Modellvarianten, verbesserte Fahrzeugkomponenten, aber auch Kundenkontakte über Avatare, automatisierte Bestellsysteme und Lageroptimierungen bis hin zu computergesteuerter Verkehrslenkung mit minimierter Umweltbelastung und KI-optimierter Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. Insbesondere für junge Menschen dürfte diese Digitalisierung der Verkehrswelt eine Faszination darstellen sowie berufliche Herausforderungen und Aufstiegschancen versprechen.
Der Produktionsfaktor Arbeit
Die Volkswirtschaftslehre unterscheidet die Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital.
Waren im Bereich Arbeit Beschäftigte vor Jahren noch hinreichend verfügbar, so werden aktuell die Personalengpässe immer größer.
Das liegt unter anderem an der demografischen Entwicklung. Die geburtenstarken Jahrgänge der Generation der Babyboomer gehen sukzessiv in den Ruhestand und es kommen zu wenig junge Menschen nach (Kofa, o.D.). Auch deshalb werden im Jahr 2030 rund 4 Millionen Arbeitnehmende in Deutschland fehlen. Bereits jetzt kommt es zu Fachkräfteengpässen. Arne Joswig, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), wies darauf hin, dass im Kfz-Gewerbe trotz steigender Ausbildungszahlen allein im handwerklichen Bereich rund 10.000 Fachkräfte fehlen (ZDK, 2024).
Wie können Unternehmen dem Fachkräfteengpass entgegenwirken?
Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, sich als attraktive und moderne Ausbildungsbetriebe zu präsentieren, um junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen. Ein wichtiger Ansatzpunkt und erster Schritt ist dabei die duale Berufsausbildung. Gleichzeitig müssen sie sich als zukunftsfähige Arbeitgeber etablieren, die bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch gute Arbeitsbedingungen langfristig halten können. Der ZDK setzt hier beispielsweise auf eine gezielte Strategie: Betriebe, die gut ausbilden und gute Ausbildungsbedingungen ermöglichen, können junge Talente für eine bestimmte Zeit halten.
Ein konkretes Beispiel für das Gewinnen von Fachkräften liefert zudem das Kfz-Gewerbe mit der ZDK-Initiative "AutoBerufe – Zukunft durch Mobilität". Diese Initiative unterstützt Betriebe vom Recruiting bis zum Onboarding und beim modernen Nachwuchsmarketing. Ziel ist es, junge Menschen für eine Karriere im Kfz-Gewerbe zu begeistern und sie langfristig von den Betrieben zu überzeugen und sie als Fachkräfte zu halten.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Kommunikation mit Fachkräften. Diese spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und gleichzeitig neue Zielgruppen anzusprechen. Ein Beispiel ist die Kampagne des ZDK #wasmitautos. Mit der Kampagne macht der Verband Schülerinnen und Schüler auf die Ausbildungsberufe und Karrierepfade im Kfz-Gewerbe über Webseiten, Social-Media-Kanäle und weitere Bausteine aufmerksam.
Darüber hinaus hat der ZDK mit der Kampagne "10.000+ holen, halten, fordern" drei zentrale Handlungsfelder definiert, um Fachkräfte für die Branche zu gewinnen und zu binden:
- Investition in die Arbeitgebermarke der Branche
- Sicherstellung von guten Arbeitsbedingungen und Ausbildungsqualität
- Schaffung von modernen Berufsfeldern.
Ziel ist es, Auszubildende und Fachkräfte zu gewinnen, Vielfalt zu fördern, zum Beispiel durch Kampagnen, die gezielt Frauen, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder Menschen mit Migrationsgeschichte für die Branche begeistern sollen. Ähnliche Ziele werden auch in anderen Handwerksbereichen verfolgt und definiert.
Die Produktionsfaktoren Boden und Kapital
Jedes Gewerbe benötigt Gewerbeflächen, möglichst groß, verkehrsgünstig gelegen und kundennah. Spielte der Faktor Boden für das Kfz-Gewerbe in der Vergangenheit keine so große Rolle, da genügend Gewerbeflächen mit guter Erreichbarkeit und zu akzeptablen Pacht- oder Kaufpreisen zur Verfügung standen, wird er jetzt durch die steigenden Immobilienpreise, zunehmenden Wohnungsbau und die immer größeren Umweltschutzauflagen bedeutsamer. Insbesondere in größeren Städten sind Gewerbeflächen kaum noch erhältlich, sodass die Betriebe an den Stadtrand verlagert werden müssen, was längere Anfahrtswege für die Kundinnen und Kunden und bei vielen Kfz-Werkstätten sogar ein eigenes Ersatzwagen-Verleihsystem erfordert.
Der Faktor Kapital beinhaltet die finanziellen Mittel, die für die Errichtung und den Betrieb eines Unternehmens erforderlich sind. Dies beinhaltet die Kosten für den Erwerb der Gewerbefläche und die erforderlichen Gebäude, die Anschaffungskosten für die Maschinen und Anlagen genauso wie die laufenden Aufwendungen für Arbeitslöhne, Ersatzteil- und Schmierstoffkäufe, Büromittel, Werbung, Internetanbindung und so weiter.
Bei Autoverkäufen muss der Betrieb vielfach vorfinanzieren, was ebenfalls große Geldmittel erfordert. Kann dies nicht aus eigenen finanziellen Mitteln erfolgen, müssen unter Umständen Kredite aufgenommen werden, was zu Zinsbelastungen und Rückzahlungsverpflichtungen führt. Damit wird neben der allgemeinen Preis- und Tariflohnentwicklung auch die Höhe der Kreditzinsen zu einer entscheidenden Stellgröße für das Kfz-Gewerbe.
Das ökonomische Prinzip
Grundlegend für jegliches Wirtschaften ist das sogenannte "Ökonomische Prinzip". Ein Unternehmen kann auf Dauer nur erfolgreich arbeiten, wenn es schafft, mit den eingesetzten Mitteln (Betriebsmittel, Arbeitskräfte, Rohstoffe) einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen. Oder anders formuliert: wenn es gelingt, ein bestimmtes Ziel (zum Beispiel einen durchschnittlichen Wartungsauftrag) mit möglichst geringem Mitteleinsatz an Zeit und Geld zu erreichen. Dieses Prinzip ist im Übrigen universell und gilt auch für unser Privatleben. Auch wir versuchen, eine bestimmte Reise oder einen Hotelaufenthalt zu möglichst geringen Kosten zu buchen. Auch wir versuchen, mit einem Etat von zum Beispiel 1.200 Euro einen möglichst schönen Urlaub zu verbringen.
Nachhaltigkeit
Ein weiteres universelles Prinzip ist die Nachhaltigkeit. Wir alle können auf unserem Planeten Erde nur dann in Frieden und Wohlstand weiterleben, wenn wir ihn nicht so schädigen, dass menschliches Leben nicht mehr möglich oder der Aufwand dafür so hoch ist, dass wir die Gelder hierfür nicht mehr aufbringen können. Auch die Automobilindustrie und das Kfz-Gewerbe müssen ihre Produktion und ihr Handeln so ausrichten, dass es nachhaltig ist.
Dabei hat Nachhaltigkeit drei Dimensionen:
Ökologisch: Das Unternehmen sollte die Umwelt möglichst wenig belasten. Ökonomisch gesprochen: Der Ertrag aus dem Wirtschaften muss größer sein als die Kosten zur Beseitigung der verursachten Umweltschäden. Und gerade im Kfz-Bereich legen die Kunden immer höhere Maßstäbe in Bezug auf Umweltschäden an. Auch das Gewerbe selbst setzt sich zunehmend mit dem Thema auseinander und definiert es als Thema der Zukunft. Dabei muss der gesamte Produktionszyklus betrachtet werden: von der Rohstoffgewinnung und Materialbeschaffung über die Produktion bis hin zu Recycling und Wartung von Autos und Autoteilen (ZDK & Heinze, 2024). Das fängt im Kleinen an, wenn es darum geht, Autoreifen zu recyceln und nachhaltiger zu gestalten, und geht bis hin zu Überlegungen, die Mobilität zu verändern, etwa durch mehr Elektroautos oder Autos mit Hybridantrieb.
Sozial: Nur bei einer fairen Behandlung und Bezahlung der Arbeitskräfte werden diese ihre Arbeitskraft optimal einbringen und zugleich die Mittel haben, die für die gesamtgesellschaftliche Nachfrage nach Gütern notwendig sind.
Ökonomisch: Jedes Unternehmen muss so wirtschaften, dass es auf Dauer erfolgreich ist und auf Dauer bestehen bleibt. Ein kurzfristiger Erfolg (zum Beispiel durch Betrug der Kundschaft oder Ausnutzen von Gesetzeslücken) nützt wenig, wenn das Unternehmen anschließend Umsatzeinbußen erleidet oder sogar insolvent wird.
Nachhaltigkeit im Handwerk
Diese Auffassung, dass Nachhaltigkeit bei jeder unternehmerischen Handlung mitgedacht werden muss, ist im Handwerk weit verbreitet. Deshalb wurde ein Leitfaden entwickelt, um nachhaltiges Wirtschaften in Handwerksbetrieben sichtbar zu machen. Nachhaltigkeit wird dabei als Wesenskern des Handwerks definiert. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird unter anderem mit dem Bestreben verbunden, den ökologischen Fußabdruck zu verringern, Mitarbeitende zu finden und zu binden, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, sowie die Unternehmensnachfolge zu sichern. Nachhaltigkeit ist also ein großes Vorhaben, das sich auf verschiedene Aspekte bezieht.
Erfolgreiches Wirtschaften als Jonglieren mit Unsicherheiten
Jedes Unternehmen muss in diesem Gesamtsystem mit zahllosen Einflussfaktoren täglich weitreichende Entscheidungen treffen, deren Auswirkungen es aber nur sehr begrenzt abschätzen kann: Soll der Betrieb ein weiteres Firmengelände anmieten? Soll man mehr Ausbildungsplätze anbieten? Soll man zusätzliche Werbung in der Tageszeitung oder im Internet schalten? Soll man neue Werkstattausrüstung kaufen? Soll man den Betrieb hauptsächlich auf E-Autos umstellen? Soll man sich auf eine Automarke spezialisieren? Soll man langjährigen Kundinnen und Kunden Rabatte gewähren? Diese und viele andere Fragen stellen sich.
Jede dieser Entscheidungen kann richtig sein und die wirtschaftliche Situation der Unternehmung verbessern. Jede Entscheidung kann aber auch falsch sein, hohe Kosten hervorrufen oder gar den Bestand des Unternehmens gefährden. Chancen und Risiken sind abzuwägen. Gerade die Abwägung solcher Fragen anhand konkreter Beispiele bietet sich für die Behandlung im Unterricht an. Wirtschaften ist somit ein überaus spannender Drahtseilakt mit gravierenden Auswirkungen auf Arbeitsplätze, das lokale Umfeld und die Umwelt.
Wirtschaftliche Fragestellungen veranschaulichen: Exemplarische Aufgaben am Beispiel des Kfz-Gewerbes
Standortfaktoren
Auch ohne besondere wirtschaftliche Vorkenntnisse können Schülerinnen und Schüler Überlegungen zur Standortwahl für verschiedene Dienstleistungsangebote anstellen. Denkbare Projekte umfassen beispielsweise einen Service für die Wiederaufbereitung alter Fahrzeugteile, ein Café-Drive-in mit integrierter Fahrzeugreinigung oder einen Showroom für virtuelle Wohnmobilkäufe. In Gruppenarbeit erarbeiten die Schülerinnen und Schüler Standortvorschläge und diskutieren, ob der städtische oder ländliche Raum geeigneter ist. Jede Gruppe präsentiert schließlich ihre Entscheidung und die Gründe, die sie zu dieser Lösung geführt haben.
Marketing
Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Aufgabe, ein Werbekonzept für neue, autonom fahrende Kleinwagen zu entwickeln. An wen wendet man sich? Wie spricht man die Kundinnen und Kunden an? Über welche Kanäle wirbt man? Mit welchen Argumenten könnte man die Kundinnen und Kunden gewinnen? Wie könnte eine Internetkampagne oder Webseite aussehen? Auch hier könnten die Lernenden arbeitsgleich an Lösungen arbeiten und diese anschließend zur Diskussion stellen.
Fachkräfteengpass und wirtschaftliche Stabilität
Eine denkbare Aufgabe könnte darin bestehen, die Lernenden dazu anzuregen, die Bedeutung von Fachkräften für die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens zu erkennen. Sie könnten untersuchen, welche Faktoren ein Unternehmen für Fachkräfte und Auszubildende attraktiv machen und inwiefern diese Faktoren zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität beitragen. Aufbauend auf der Kampagne des Kfz-Gewerbes („10.000+ holen, halten, herausfordern“) könnten Strategien zur Fachkräftegewinnung entwickelt werden, die gezielt auf die Wünsche und Bedingungen der Lernenden eingehen. Abschließend könnten die Lernenden ihre Strategien in einem kurzen Elevator-Pitch zusammenfassen und vorstellen.
Verwendete Literatur
Möhlmann, P., Berndt, T., Kühn, G., Lutz, K., Gebert, D. & Hausener-Witkovsky, S. (2023). Automobilkaufleute. 1. Ausbildungsjahr. Braunschweig: Westermann.
Verwendete Internetadressen
autoberufe.de: Werkzeugkasten Recruiting. Online: https://autoberufe.de/werkzeugkasten-recruiting (abgerufen am 17.02.2025).
kfzgewerbe.de: AutoBerufe im digitalen Wandel. Online: https://www.kfzgewerbe.de/presse/publikationen/promotor/archiv-1/autoberufe-im-digitalen-wandel (abgerufen am 25.09.2024).
kfzgewerbe.de: Unsere Fachkräftestrategie für das Kfz-Gewerbe 2024. Online: https://www.kfzgewerbe.de/initiativen/fachkraeftestrategie (abgerufen am 26.09.2024).
kfzgewerbe.de: Zahl der Auszubildenden erneut gestiegen. Online: https://www.kfzgewerbe.de/kfz-gewerbe-zahl-der-auszubildenden-erneut-gestiegen-fachkraefte-fehlen (abgerufen am 12.10.2024).
kofa.de: Fachkräftemangel. Online: https://www.kofa.de/daten-und-fakten/ueberblick-fachkraeftemangel/ (abgerufen am 23.01.2025).
wasmitautos.com: Starte deine Karriere und mach #wasmitautos. Online: https://www.wasmitautos.com/ (abegrufen am 17.02.2025).
ZDK & Heinze, E.-M. (2024): Nachhaltigkeit im Kfz-Gewerbe. handwerk-macht-schule.de. Online: https://www.handwerk-macht-schule.de/faecherwelt/faecheruebergreifender-unterricht/artikel/fa/saubere-autos-nachhaltigkeit-im-kfz-gewerbe/(abgerufen am 26.09.2024).
Weiterführende Literatur
Graf, J. (2022): BWL – Kompaktes Grundwissen: Eine leicht verständliche Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für Praktiker, Selbstständige, Ingenieure und alle, die kein BWL studiert haben. München: Fachmedia Business Verlag.
Hess, E.: Betriebswirtschaft (2009). Der sichere Weg zur Meisterprüfung im Kfz-Techniker-Handwerk. Würzburg: Vogel Buchverlag.
Weitz, B. (Hrsg.), Kürht, P. (2002): Volkswirtschaft für Wirtschaftsschulen in Bayern. Schülerband. Braunschweig: Westermann.
Fachartikel "Wirtschaftliches Denken und Handeln: Anwendung und Förderung im Lernfeld Kfz-Gewerbe" zum Download
- Fachartikel "Wirtschaftliches Denken und Handeln: Anwendung und Förderung im Lernfeld Kfz-Gewerbe"
Dieser Fachartikel zeigt, wie das Kfz-Gewerbe als anschauliches und praxisnahes Beispiel wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich vermittelt und dabei Anknüpfungspunkte zu lehrplanrelevanten Themen aus Politik und Wirtschaft der Sekundarstufe I und II bietet.
Link-Tipps
- Gründerplattform: Kfz-Werkstatt eröffnen
Hier finden Sie Antworten auf wirtschaftliche Fragestellungen rund um die Existenzgründung im Kfz-Bereich.